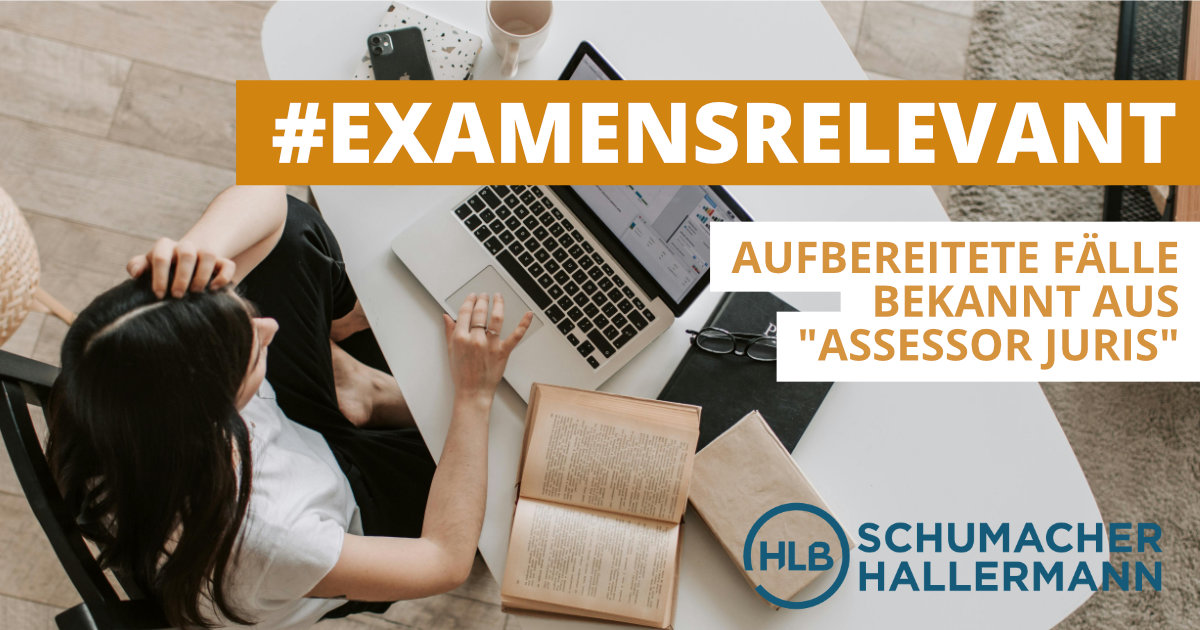
Aufbereitete Fälle bekannt aus Assessor Juris
In Kooperation mit der Kanzlei HLB Schumacher Hallermann präsentieren wir dir die aus unserem Leitfaden Assessor Juris bekannten examensrelevanten Fällen. Diese werden unter der Supervision von Rechtsanwalt Dr. Lennart Brüggemann sowie mit Unterstützung seines Teams aus qualifizierten wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen und Referendar:innen für dich und deine Fallbearbeitung ausformuliert bzw. bearbeitet.
Der Verfasser dieses Beitrags ist Christian Lederer, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei HLB Schumacher Hallermann.
Es geht um einen Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts (NdsOVG) vom 10.02.2022 – 11 ME 369/21.
Hinweis vom HLB-Team:
Tierschutzrechtliche Fälle erfreuen sich in der Examensprüfung wachsender Beliebtheit. Sie stellen den Prüfling vor ein weithin unbekanntes Gesetz (TierSchG), bieten Raum die Rechtmäßigkeit von Verwaltungsmaßnahmen (z.B. Tierhaltungs- und Betreuungsverbote) sowie die Rechtsschutzmöglichkeiten des Betroffenen zu prüfen, insb. den einstweiligen Rechtsschutz aus dem Verwaltungsrecht.
In dieser Entscheidung – getreu dem Motto „Eine Kuh macht muh, viele Kühe machen Mühe.“ – hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (NdsOVG) mit Beschluss v. 10.02.2022 (11 ME 369/21) getroffen. Zugrunde liegt die Beschwerde eines Landkreises gegen einen Beschluss des VG Oldenburg (Beschl. v. 04.11.2021 – 7 B 2932/21), in dem das Verwaltungsgericht (VG) auf Antrag eines Landwirts die aufschiebende Wirkung seiner Klage gegen eine vom Landkreis verfügte Auflösung des Rinderbestandes wiederhergestellt hat. Lehrreich ist der Beschluss des NdsOVG gerade wegen der vertieften Auseinandersetzung mit dem TierSchG und seiner Systematik.
Und noch ein paar Hintergrundinformationen an die Hand: Der gesetzliche Tierschutz fällt nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 20 GG in die Zuständigkeit der konkurrierenden Gesetzgebung, wobei der Bund von seiner Kompetenz, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen, nach Art. 72 Abs. 2 GG wegen des Bedürfnisses nach einer bundeseinheitlichen Regelung Gebrauch gemacht hat. Der zu- nehmende europäische Integrationsprozess und darüber hinausgehende internationale Verpflichtungen bedingen jedoch, dass zum gesetzlichen Tierschutz verschiedene Regelungsebenen gehören.
Die Hintergründe zur Entscheidung
Bereits im Jahr 2017 untersagte der zuständige Landkreis dem Landwirt und späteren Kläger und Antragsteller unter Anordnung des Sofortvollzugs die Lieferung der in seinem Betrieb erzeugten Rohmilch als Lebensmittel und führte zur Begründung aus, dass in einer Milchprobe ein zu hoher Wert an Keimen festgestellt worden sei. In der Folgezeit wurden im Rahmen von Kontrollen der Amtstierärzte immer wieder diverse tierschutzrechtliche Mängel festgestellt. Die Qualität der Rohmilch indes entsprach auch in den folgenden Jahren nicht den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 hinsichtlich des Gehalts an somatischen Zellen.
Konsequenz der Auseinandersetzung war Ende 2020 eine Verfügung, mit welcher die Behörde gegenüber dem Landwirt verschiedene, sofort vollziehbare tierschutzrechtliche Maßnahmen anordnete (u.a. ausreichende Versorgung der Rinder mit Futter und Wasser, regelmäßige Säuberung der Liegeflächen, Vorlage eines schlüssigen Konzepts zur künftigen Führung des Betriebs, die Hinzuziehung eines Tierarztes bei kranken und verletzten Tieren). Für den Fall der Nichtbefolgung waren Zwangsgelder angedroht. Bei einer im April 2021 durchgeführten Vor-Ort-Kontrolle des Betriebs wurden sodann durch die Amtstierärzte weitere Verstöße gegen tierschutz- und tierseuchenrechtliche Bestimmungen festgestellt. Mit Anhörungsschreiben vom 3. Juni 2021 führte der zuständige Landkreis aus, dass er beabsichtige, die Aufgabe der Rinderhaltung anzuordnen. Zugleich wies er darauf hin, dass er ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot für Nutztiere in Betracht ziehe. Eine Strafanzeige gegen den Landwirt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz folgte. Mit Schreiben vom 29. Juli 2021 hörte der Landkreis den Landwirt zum Erlass eines Tierhaltungs- und Betreuungsverbots sowie zum Erlass eines Nutzungsverbots des Stalls an.
Mit dem streitgegenständlichen Bescheid vom 3. August 2021 ordnete der Landkreis sodann die Auflösung des Rinderbestands des Landwirts von 120 Rindern bis zum 31. Oktober 2021 an, gestützt auf die Regelungen in § 16 a Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 TierSchG. Weiter führte die handelnde Behörde aus, dass sie in dem Fall, dass der Landwirt dieser Anordnung nicht oder nicht vollständig nachkomme, die Fortnahme und Veräußerung der Tiere veranlassen werde. Es wurde die sofortige Vollziehung angeordnet. Ein Tierhaltungs- und Betreuungsverbot wurde dagegen nicht ausgesprochen.
Die Entscheidung
Gegen diesen Bescheid erhob der Landwirt fristgemäß Klage vor dem Verwaltungsgericht (VG) Oldenburg und beantragte zugleich die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes gemäß § 80 Abs. 5 S. 1 Alt. 2 VwGO. Der Antrag des Landwirts hatte Erfolg, und das VG stellte die aufschiebende Wirkung der Klage gegen den Bescheid vom 3. August 2021 wieder her.
Der Landkreis ließ die Angelegenheit jedoch nicht auf sich beruhen und legte gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Beschwerde vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht (NdsOVG) ein.
Das NdsOVG änderte den Beschluss des VG ab und lehnte den Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes ab. Zu Beginn stellte das Gericht den Prüfungsumfang klar, der in der Praxis nicht selten übersehen wird. Im Beschwerdeverfahren ist das Oberverwaltungsgericht gemäß § 146 Abs. 4 S. 6 VwGO lediglich auf die Überprüfung der im Beschwerdeverfahren dargelegten Gründe beschränkt.
Betrachten wir zunächst – so auch das NdsOVG – den Tatbestand der Rechtsgrundlage für die Auflösungsanordnung etwas genauer: „Nach § 16 a Abs. 1 Satz 1 TierSchG trifft die zuständige Behörde die zur Beseitigung festgestellter Verstöße und die zur Verhütung künftiger Verstöße notwendigen Anordnungen. Insbesondere kann sie nach § 16 a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TierSchG im Einzelfall die zur Erfüllung der Anforderungen des § 2 TierSchG erforderlichen Maßnahmen anordnen.
§ 2 Nr. 1 TierSchG besagt wiederum, dass derjenige, der ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, dieses seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen muss“. Die auf der Grundlage von § 2 a TierSchG ergangene Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung konkretisiert letztere Vorgaben des § 2 TierSchG. Unter Verweis auf die Feststellungen in den Verwaltungsvorgängen kommt das NdsOVG zu dem Ergebnis, dass die Rinderhaltung im maßgeblichen Zeitpunkt des Erlasses des streitgegenständlichen Bescheides die vorgezeichneten normativen Anforderungen nicht genügte (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 10, BeckRS 2022, 2125).
Sodann beschäftigt sich das NdsOVG mit den im Beschwerdeverfahren dargelegten Gründen, auf die die gerichtliche Prüfung – wie schon angemerkt – gemäß § 146 Abs. 4 S. 6 VwGO beschränkt ist. Dabei erweisen sich die Einwände des Landwirts im Ergebnis als fruchtlos. So kann die pauschale Behauptung des Landwirts, sich keinerlei Tierquälerei schuldig gemacht zu haben, die dokumentierten amtsärztlichen Feststellungen von Verstößen gegen Vorgaben des TierschG und der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung nicht entkräften. Dabei weist das NdsOVG darauf hin, dass amtlichen Tierärzten eine vorrangige Beurteilungskompetenz zustehe, deren Feststellungen zwar durch substantiierte fachliche Stellungnahmen anderer Amtstierärzte und Fachärzte in Frage gestellt werden können, nicht aber – wie hier – durch schlichtes Bestreiten (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 12, BeckRS 2022, 2125).
Lesenswert sind ferner die Ausführungen zum Einwand des Landwirts, dass der streitgegenständliche Bescheid auch deshalb rechtswidrig sei, weil es an Tatsachen fehle, die die Annahme rechtfertigten, dass er „weiterhin derartige Zuwiderhandlungen begehen wird“. Hierbei bezieht er sich auf die in § 16 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TierSchG normierten Voraussetzungen zum Erlass eines Haltungs- und Betreuungsverbots. Das Gericht arbeitet hier juristisch präzise und verdeutlicht, dass „mit dem streitgegenständlichen Bescheid […] kein auf § 16 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TierSchG gestütztes Haltungs- und Betreuungsverbot, sondern […] eine auf § 16 a Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 1 TierSchG gestützte tierschutzrechtliche Anordnung erlassen“ wurde. Eine Prognose ist demnach nicht erforderlich. Unabhängig davon, weist das NdsOVG darauf hin, „dass eine negative Prognose im Rahmen des § 16 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TierSchG in der Regel bereits dann gerechtfertigt ist, wenn es in der Vergangenheit – wie hier – zu einer Vielzahl von Verstößen gekommen ist“ (vgl. zum Ganzen NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 13, BeckRS 2022, 2125).
Fehler im Auswahlermessen bezogen auf die Wahl des (verhältnismäßigen) Handlungsmittels aus § 16 a Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr. 1 TierSchG sind weder vom Antragsteller vorgetragen noch für den Senat ersichtlich“ (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 14, BeckRS 2022, 2125).
Der Schwerpunkt der oberverwaltungsgerichtlichen Würdigung lag in der Frage nach der Notwendigkeit eines vorherig oder zeitgleich erlassenen Tierhaltungs- und Betreuungsverbotes. Für dessen Notwendigkeit hatte sich das VG Oldenburg ausgesprochen und in der Folge den Bescheid als rechtswidrig angesehen. Zu einem anderen Ergebnis kam hingegen das NdsOVG (vgl. ausführlich NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 17 ff., BeckRS 2022, 2125). Das Gericht erinnert daran, dass Sinn und Zweck des § 16 a Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr.1 TierSchG ist, der Behörde die Anordnungsbefugnis zur Herbeiführung tierschutzrechtlich ordnungsgemäßer Zustände zur Verfügung zu stellen (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 19, BeckRS 2022, 2125). Dabei sprächen der Wortlaut und der Sinn und Zweck der Vorschriften dafür, dass der Behörde „ein möglichst breites, den jeweiligen Umständen eines jeden Einzelfall gerecht werdendes Auswahlermessen eingeräumt werden soll, welches ausschließlich durch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geleitet und beschränkt wird“ (vgl. ebenso NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 19, BeckRS 2022, 2125). Dem widerspräche es, der Behörde eine „Stufenreihenfolge“ für ihr Handeln aufzuerlegen. Vielmehr ginge es darum, ein rasches und wirksames behördliches Eingreifen zu ermöglichen (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 20, BeckRS 2022, 2125).
Letztlich stellt das NdsOVG in seiner summarischen Prüfung nach § 80 Abs. 5 VwGO (vgl. hierzu später „Dogmatische Vertiefung“-Teil) fest, dass davon auszugehen sei, dass sich der streitgegenständliche Bescheid des Antragsgegners […] als rechtmäßig erweise und daher dem öffentlichen Interesse am Vollzug der tierschutzrechtlichen Anordnungen ein höheres Gewicht beizumessen sei als dem privaten Interesse des Antragstellers an der Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung seiner dagegen erhobenen Klage (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 10.2.2022 – 11 ME 369/21, Rn. 8, BeckRS 2022, 2125).
Dogmatische Vertiefung
JurCase informiert:
Du interessierst dich für eine gelungene Examensvorbereitung auch für die dogmatische Vertiefung zu dieser Entscheidung? Kein Problem! Die komplette Besprechung des Falls nebst dogmatischer Vertiefung gibt es hier für dich zum kostenlosen Download:
HIER DOWNLOADENAssessor Juris jetzt kostenlos downloaden!
In unserem E-Book Assessor Juris findest du jedoch nicht nur die Kategorie #Examensrelevant mit examensrelevanten Fällen, sondern es bietet darüber hinaus noch so viel mehr:
- Erhalte in unserer Rubrik #Referendariat wertvolle Einblicke rund um den juristischen Vorbereitungsdienst, in dieser Ausgabe sind das erneut besondere Einblicke in die jeweiligen Stationen.
- In der Rubrik #Gewusst erhältst du indes nützliche Insights u.a. zur aktuellen Rechtsprechung aus dem Zivil-, dem Straf- und dem Öffentlichen Recht.
- Mit dem Erwerb des Titels „Assessor Juris“ und dem damit zusammenhängenden Abschluss der juristischen Ausbildung geht es in den #Karrierestart. In dieser Rubrik findest du deshalb hilfreiche Tipps und Tricks von Praktiker:innen zum Karriereeinstieg.
Wer sind HLB Schumacher Hallermann?
HLB Schumacher Hallermann ist eine mittelständische Rechtsanwaltskanzlei, die von der steuerzentrierten Rechtsberatung kommt und sich nunmehr intensiv auch auf klassische Rechtsgebiete ausrichtet hat. Besonderes Merkmal: Konsequente Entwicklung spezieller und innovativer Beratungsfelder (Glücksspielbesteuerung, Glücksspielregulierung, eSport). Aus dem Herzen von Münster heraus beraten wir Mandanten persönlich und lösungsorientiert. Dabei ist uns eine offene und ehrliche Kommunikation gegenüber dem Mandanten wichtig.
Erfahre hier mehr:
Oder bewirb dich direkt hier:

