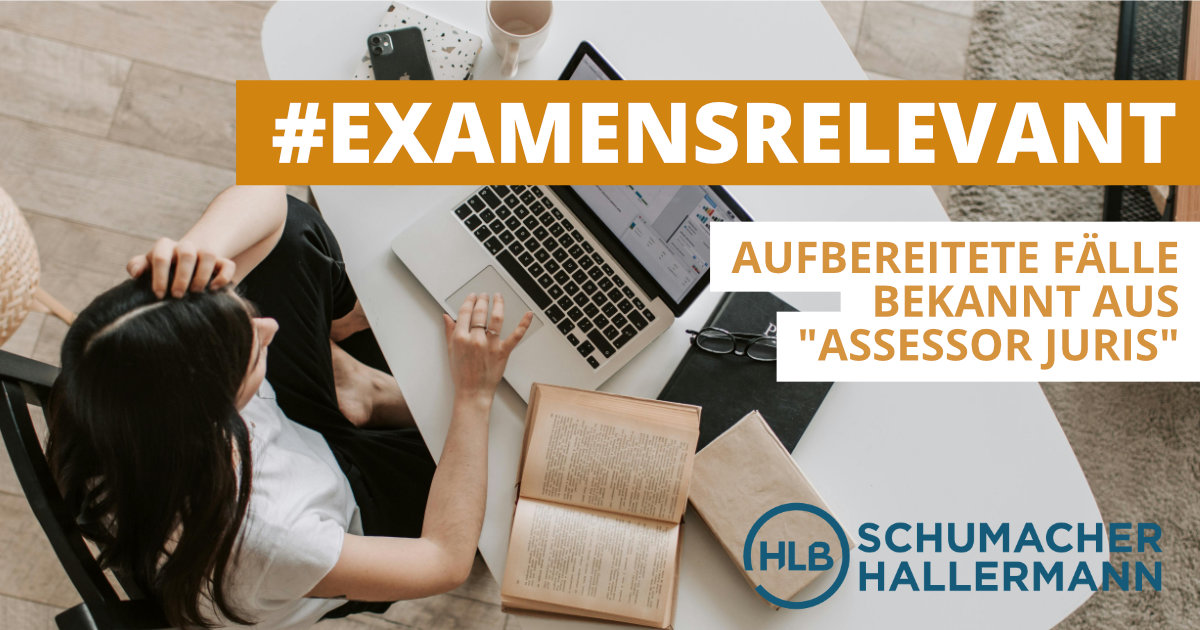
Aufbereitete Fälle bekannt aus Assessor Juris
In Kooperation mit der Kanzlei HLB Schumacher Hallermann präsentieren wir dir die aus unserem Leitfaden Assessor Juris bekannten examensrelevanten Fällen. Diese werden in der Regel unter der Supervision von Rechtsanwalt Dr. Lennart Brüggemann sowie mit Unterstützung seines Teams aus qualifizierten wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen und Referendar:innen für dich und deine Fallbearbeitung ausformuliert bzw. bearbeitet.
Der Verfasser dieses Beitrags ist Christian Lederer, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei HLB Schumacher Hallermann. Die Supervision dieses Beitrags erfolgte ausnahmsweise von Rechtsanwalt Christian Cremers.
Es geht um einen Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts (NdsOVG) vom 03.05.2022 – 1 ME 31/22.
JurCase informiert:
Du möchtest dir diese Entscheidung parallel zur Falllösung durchlesen?
Kein Problem! Sie ist kostenlos hier abrufbar.
Hinweis vom HLB-Team:
Die Abfrage des (landesspezifischen) Verwaltungsrechts kann in verschiedensten Facetten erfolgen. Wie kein anderes Fach erfordert gerade das besondere Verwaltungsrecht angesichts häufig unbekannter Rechtsvorschriften Systemkenntnis und die Beherrschung des allgemeinen juristischen Instrumentariums. So kann im Rahmen einer baurechtlichen Klausur u.a. auch das Denkmalschutzrecht eine tragende Rolle spielen. In Deutschland gibt es 16 Denkmalschutzgesetze (DSchG). Die Gesetzgebungskompetenz für den Denkmalschutz liegt vor dem Hintergrund ihrer Kulturhoheit auf Ebene der Länder (vgl. Art. 18 Abs. 2 LV NRW; Kompetenzvermutung des Grundgesetzes: Art. 70 Abs. 1 GG ist lex specialis zu Art. 30 GG: Für Gegenstände, die nicht ausdrücklich als Kompetenztitel dem Bund zugewiesen werden, sind die Länder zuständig.).
In Deutschland gibt es gut eine Million Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen. Dieser Rechtsstatus belastet nicht selten die Denkmaleigentümer, weil sie aufgrund des entsprechenden DSchG zum Erhalt ihres Denkmals verpflichtet sind. Das kann eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen und Eigentümer in ihrem Eigentumsrecht (Art. 14 GG) beschränken. Die Zulässigkeit richtet sich dabei i.d.R. nach der Zumutbarkeit. Die Sonderbelastung des Denkmaleigentümers findet ihre Rechtfertigung in Art. 14 Abs. 2 S. 2 GG, der Sozialbindung des Eigentums.
Eine Entscheidung mit Bezug zu diesem Hintergrund hat nun das Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Beschl. v. 03.05.2022 – 1 ME 31/22) getroffen. Im Kern ging es um die Frage, ob baubehördliche Anordnungen auch gegenüber dem ehemaligen Eigentümer eines Grundstücks getroffen werden können. Das in Frage stehende Eigentumsobjekt – ein unter Denkmalschutz gestelltes Fachwerkhaus – war stark baufällig geworden. Der Eigentümer per hereditatem (= von Erbes wegen) hatte vor Erlass der behördlichen Anordnung bereits einen Eigentumsverzicht ins Grundbuch eintragen lassen. Lehrreich ist der Beschluss, da das OVG in seiner Prüfung die aus dem Grundgesetz folgenden Pflichten des Eigentümers (Art. 14 Abs. 2 S. 1 GG) im Lichte der Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) diskutiert.
Die Hintergründe zur Entscheidung
Das NdsOVG hatte als Beschwerdegericht im einstweiligen Rechtsschutz über die Zulässigkeit einer Rückbauverpflichtung zu entscheiden (vgl. NdsOVG, Beschl. v. 03.05.2022 – 1 ME 31/22, Rn. 1). Zuvor hatte das VG Göttingen diese bauordnungsrechtliche Verfügung bestätigt, mit der die Eigentümer zum Rückbau des bereits teileingestürzten Gebäudes verpflichtet worden sind.
Das betroffene Fachwerkwohnhaus wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in der Stadt Bad Sachsa errichtet und 1988 in das Denkmalverzeichnis eingetragen.
Im Jahr 2011 erbten die Antragsteller die bereits zu diesem Zeitpunkt sanierungsbedürftige Immobile. Der ursprüngliche Eigentümer unternahm bereits im Jahr 2006 erfolglos den Versuch, den Denkmalschutz zwecks Abbruch aufzuheben.
Die Frage des Verlusts der Schutzwürdigkeit eines Denkmals stellt sich erst, wenn keine Aussicht mehr besteht, dass gravierende Beeinträchtigungen eines Baudenkmals wieder rückgängig gemacht werden können. Auch ein schlecht erhaltenes oder anderweitig beeinträchtigtes Denkmal ist schützenswert, solange es nicht unrettbar verloren ist (vgl. dazu: NdsOVG, Beschl. v. 31.03.2022 – 1 LA 26/21, BeckRS 2022, 6346, Rn. 10).
Die wirtschaftliche Zumutbarkeit sei weit auszulegen, der hypothetische Grundstückswert zu berücksichtigen. Vorliegend erfolgte ein Hinweis durch den damals zuständigen Landkreis an einen der Antragsteller im Jahr 2012, nachdem ein Anwohner mitgeteilt hatte, dass eine Windfeder (Dachuntersicht vom Giebelüberstand) auf den Gehweg zu stürzen drohte. Das Dach des Hauses sei zu reparieren. Im Jahr 2013 erkundigte sich die Behörde nach dem Sachstand; weitere Reaktionen blieben aus. 2014 erklärten die Antragsteller dann den Verzicht auf das Eigentum inkl. Eintragung ins Grundbuch (§ 928 Abs. 1 BGB).
Nachdem im Jahr 2017 Dachziegel auf das Nachbargrundstück gefallen waren, verpflichtete der nun zuständige Landkreis Göttingen die Antragsteller im Februar 2019 auf Grundlage des DSchG zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen. Hiergegen erhoben die Antragsteller Klage. Parallel zum gerichtlichen Verfahren stürzte 2021 ein Teil des Hauses ein.
Der Landkreis Göttingen ließ das verbliebene Gebäude auf seine Statik prüfen, mit dem Ergebnis, dass es nicht mehr standsicher sei. Ein weiterer Einsturz könnte dazu führen, dass Baumaterial auf den angrenzenden Gehweg und das Nachbargrundstück fällt. Daher gab er den Antragstellern nach vorheriger Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege mit für sofort vollziehbar erklärtem Bescheid vom 09.12.2021 auf, innerhalb von vier Wochen das Fachwerkwohnhaus bis zur Oberkante des Kellers fachgerecht zurückzubauen und den Keller des Gebäudes zu verschließen. Zugleich drohte er die Ersatzvornahme an. Die Antragsteller legten einerseits Widerspruch gegen den VA ein und ersuchten andererseits um einstweiligen Rechtsschutz (vgl. NdsOVG, a.a.O., Rn. 10). Sie sind der Ansicht, dass sie nicht in Anspruch genommen werden könnten, nachdem sie bereits im Jahr 2014 auf das Eigentum an der Immobilie verzichtet hätten. Zu diesem Zeitpunkt sei noch keine Gefahr von dem Gebäude ausgegangen. Jedenfalls seien Aufwendungen auf das Grundstück nicht zumutbar.
Den Antrag auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes lehnte das VG Göttingen ab. Der Landkreis dürfe die Antragsteller für den Rückbau in Anspruch nehmen. Der im Jahr 2014 ausgeübte Eigentumsverzicht (§ 928 BGB) sei nach § 138 BGB sittenwidrig und daher unwirksam. „Von einer Sittenwidrigkeit sei dann auszugehen, wenn zum Zeitpunkt des Entschlusses zur Eigentumsaufgabe konkrete Anhaltspunkte dafür bestünden, dass der Derelinquent mit seiner Heranziehung rechnen müsse und er sich dieser Verpflichtung durch die Eigentumsaufgabe zulasten der Allgemeinheit entledigen wolle“ (vgl. NdsOVG, a.a.O., Rn. 11). Eine Inanspruchnahme der Antragsteller war im Zeitpunkt des Entschlusses zur Eigentumsaufgabe wenigstens vorhersehbar. Entgegen des Vortrags der Antragsteller ginge sehr wohl bereits zu diesem Zeitpunkt eine Gefahr von dem Gebäude aus. Dies sei durch Lichtbilder und Anwohnerhinweise auf Schäden am Dach belegt. Ein behördliches Einschreiten habe auch angesichts der Schreiben des ehemaligen Landkreises aus den Jahren 2012 und 2013 nahegelegen. Diese Umstände gäben Grund zur Annahme, dass die Antragsteller sich einer Inanspruchnahme hätten entziehen wollen. Deshalb könnten sie als Eigentümer in Anspruch genommen werden.
Der Rückbau sei auch nicht deshalb unverhältnismäßig, weil der Beseitigungsaufwand den Restwert des Grundstückes überschreite. Ausgehend vom Bodenrichtwert liege der Grundstückswert nach dem Rückbau des Fachwerkwohnhauses und Entfall der Denkmaleigenschaft voraussichtlich über den Beseitigungskosten, die vom Landkreis mit 30.000,- Euro veranschlagt wurden.
Die Entscheidung
Wenig erbaulich fiel nun der Beschluss des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts aus, der die Entscheidung der Vorinstanz bestätigte (vgl. NdsOVG, a.a.O., Rn. 12). Das OVG stellte zu Beginn klar, dass die Prüfung gem. § 146 Abs. 4 S. 6 VwGO auf die vom Antragsgegner vorgetragenen Beschwerdegründe beschränkt ist (NdsOVG, a.a.O., Rn. 12).
Sodann ging das OVG zunächst auf die Eigentümerstellung der Antragsteller ein. Betrachten wir also zunächst einmal die möglichen Tatbestände des Eigentumserwerbs. Dies geschieht traditionell originär (ursprünglich, nicht abgeleitet) kraft Gesetzes (= ipso iure; z.B. §§ 946 bis 950 BGB) oder derivativ (abgeleitet) durch Rechtsgeschäft (abgeleitet; z.B. §§ 873, 925 BGB bei Immobilien). Die Antragsteller verneinten vorliegend eine Eigentümerstellung bereits mit dem Argument mangelnder Einigung und Eintragung ins Grundbuch, § 873 BGB. Aufklärung lieferte das OVG: Der Erbe erwirbt das Eigentum gem. § 1922 Abs. 1 BGB im Wege der Gesamtrechtsnachfolge und damit ipso iure. „Das Grundbuch wird dadurch zwar unrichtig im Sinne des § 894 BGB, eine spätere Berichtigung des Grundbuchs ist aber nicht konstitutiv für den Rechtserwerb“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 14).
Hinsichtlich des weiteren Vortrags der Antragsteller, dass sie jedenfalls Eigentum am Grundstück wirksam aufgegeben haben, indem sie dies ins Grundbuch eintragen ließen, ist nun ein Blick in den allgemeinen Teil des BGB zu werfen: Im Raum steht namentlich die Sittenwidrigkeit der Eigentumsaufgabe. Diese stellen die Antragsteller jedoch in Abrede. Nicht infrage stellen die Antragsteller „den zutreffenden Ausgangspunkt des Verwaltungsgerichts […], dass ein früherer Eigentümer, der das Eigentum aufgegeben hat, gemäß § 79 NBauO in Verbindung mit § 56 NBauO für die Beseitigung eines Bauwerks in Anspruch genommen werden kann, wenn die Eigentumsaufgabe sittenwidrig und damit gemäß § 138 BGB nichtig ist“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 16). Zur Sittenwidrigkeit nennen sie Argumente, die die Redlichkeit ihrer Dereliktion stützen sollen. Sie bringen ebenso vor, dass zu diesem Zeitpunkt weder eine konkrete Gefahr von dem Grundstück ausgegangen sei noch eine abstrakte Gefahr erkennbar gedroht habe. Erst der Statiker im Jahr 2019 stellte fest, dass sich Dachziegel lösen würden (NdsOVG, a.a.O., Rn. 16).
Das OVG verwehrt sich diesem Argument. Zum Zeitpunkt der Dereliktion wussten die Antragsteller „nicht nur um den desolaten Zustand des Gebäudes, sondern auch um die aus diesem Zustand resultierenden Gefahren“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 17). Bereits der Erblasser warnte seinerseits in seinem Antrag von 2006 zwecks Aufhebung des Denkmalschutzes, dass das Gebäude einsturzgefährdet sei, sodass „hier auch Schäden an Personen und Werten der Nachbarn“ möglich seien. In einem weiteren Schreiben des Vaters und Testamentsvollstreckers von November 2011, in dem um Prüfung einer finanziellen Förderung oder einer Übernahme des Gebäudes durch die öffentliche Hand gebeten wurde, bezeichnete dieser das Gebäude als „Ruine“. „Ein so bezeichnetes Gebäude wird bereits für sich genommen in einer innerörtlichen Lage regelmäßig mit der Gefahr verbunden sein, dass es einstürzt und dabei benachbarte Gebäude beschädigt“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 17). Schließlich hätten die Antragsteller durch die Schreiben des Antragsgegners aus 2012 und 2013 Kenntnis davon, dass Passanten durch herabstürzende Dachteile (konkrete) Gefahren drohten. „Da sie daraufhin nichts unternahmen, hatten sie keinen Anlass zur Annahme, dass sich diese Gefahrensituation von selbst bis zum Zeitpunkt der Eigentumsaufgabe entschärft hatte“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 17).
In den nun folgenden Erwägungen des OVG widmet es sich dem (hypothetischen) Fall einer wirksamen Eigentumsaufgabe und dem Ausstellen der behördlichen Verfügung an die ehemaligen Eigentümer. Selbst bei wirksamer Dereliktion, so das Gericht, könnte die Behörde die Anordnung gem. §§ 79 Abs. 1 S. 3 i.V.m. § 56 Satz 4 NBauO und § 7 Abs. 3 NPOG an diesen richten (NdsOVG, a.a.O., Rn. 19).
Gemäß § 79 Abs. 1 S. 3 NBauO (alle §§ einmal mitlesen) hat die Bauaufsichtsbehörde ihre Anordnungen an die Personen zu richten, die nach den §§ 52 bis 56 verantwortlich sind. § 56 NBauO bestimmt wiederum, dass grundsätzlich der Eigentümer verantwortlich für die Vereinbarkeit seines Grundstücks mit dem öffentlichen Baurecht ist (Satz 1). Entsprechendes gilt für Erbbauberechtigte (Satz 2). Schließlich wird in Satz 4 auf den § 7 Abs. 3 NPOG verwiesen.
Der Schwerpunkt der oberverwaltungsgerichtlichen Würdigung lag nun in genau dieser Frage, ob die ehemaligen Eigentümer in rechtmäßiger Weise als Adressaten der Rückbauverfügung in Anspruch genommen werden konnten. „Die Vorschrift des § 7 Abs. 3 NPOG, auf die § 56 Satz 4 NBauO Bezug nimmt, ist von der Erwägung getragen, dass der Eigentümer, der in der Vergangenheit die Nutzungen aus dem Eigentum gezogen hat, die mit dem Eigentum einhergehenden Belastungen nicht auf die Allgemeinheit verlagern können soll. Zudem soll sie sicherstellen, dass nach einer Eigentumsaufgabe ein Verantwortlicher für das Grundstück greifbar ist“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 20).
Im weiteren Verlauf geht das OVG darauf ein, dass einer Inanspruchnahme nach der Vorschrift des § 56 Satz 4 NBauO nicht entgegenstünde, dass die Antragsteller die Dereliktion bereits 2014 und damit gut 4,5 Jahre vor dem Inkrafttreten der Vorschrift am 01. Januar 2019 tätigten. Es stellt fest, die „Anwendung § 56 Satz 4 NBauO in der Fassung vom 18. November 2020 auf die Eigentumsaufgabe im Jahr 2014 steht mit Verfassungsrecht in Einklang. Es handelt sich um eine grundsätzlich zulässige unechte Rückwirkung und nicht um eine grundsätzlich unzulässige echte Rückwirkung“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 21).
Dies führt das Gericht im Folgenden weiter aus (NdsOVG, a.a.O., Rn. 22 f.), weshalb auch wir uns ansehen wollen, wann eine Rechtsnorm Rückwirkung entfalten kann, ohne mit der Verfassung zu brechen. Wir erinnern uns: Ein grundsätzliches Rückwirkungsverbot (vgl. hierzu allgemein: BVerfGE 63, 343 [356 f.]) leitet sich aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 2 u. 3 GG) ab und dient insbesondere der Rechtssicherheit und dem Rechtsfrieden.
Für das besonders scharf in die Grundrechte einschneidende Strafrecht regelt die Verfassung in Art. 103 Abs. 2 GG gesondert die unbedingte Unzulässigkeit einer belastenden Rückwirkung. Umgekehrt gilt, dass eine begünstigende Rückwirkung immer zulässig ist. Im sonstigen Recht gilt schließlich, dass eine sog. echte Rückwirkung („Rückbewirkung von Rechtsfolgen“: wenn die Rechtsfolge der neuen Rechtsnorm mit belastender Wirkung schon vor dem Zeitpunkt ihrer Verkündung für bereits abgeschlossene Tatbestände gelten soll; vgl. BVerfGE 88, 384 [404]; 45, 142 [173]; 75, 262 [267]) grds. unzulässig ist. Die sog. unechte Rückwirkung („tatbestandliche Rückanknüpfung“: gesetzliche Regelung, die für künftige belastende Rechtsfolgen an zurückliegende Sachverhalte anknüpft, vgl. BVerfG, Beschl. v. 07.07.2010 – 2 BvL 14/02) ist wiederum grds. zulässig. Aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip können sich im Einzelfall Grenzen der Zulässigkeit ergeben. „Diese Grenzen sind erst überschritten, wenn die vom Normgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Erreichung des Normzwecks nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn das Vertrauen des Einzelnen auf die Fortgeltung der Rechtslage das Gemeinwohlinteresse des Normgebers an der Rechtsänderung ausnahmsweise überwiegt. Für das Gewicht des Vertrauensschutzes kommt es auf die betroffenen, in der Regel grundrechtsgeschützten Rechtsgüter und die Intensität der Nachteile an“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 22).
Gut nachvollziehbar subsumiert das OVG den Sachverhalt der Eigentumsaufgabe von 2014 unter die Formel der unechten Rückwirkung und des Vertrauensschutzes im Falle der Antragsteller: Die „Anknüpfung an eine bereits vor Inkrafttreten der Norm erklärte Eigentumsaufgabe [sei] jedenfalls nicht grundsätzlich als unzulässig zu bewerten. Ein Vertrauen darauf, sich durch Eigentumsaufgabe aller mit dem Grundeigentum verbundenen Pflichten entledigen zu können, war bereits nach alter Rechtslage nicht in vollem Umfang gerechtfertigt. Ein Eigentümer, der auf das Eigentum an seinem Grundstück verzichtet, musste auch vor Inkrafttreten der Neuregelung des § 56 Satz 4 NBauO nach der Eigentumsaufgabe mit einer Inanspruchnahme wegen des Zustands dieses Grundstücks gemäß § 1004 BGB durch private Dritte rechnen. In der zivilgerichtlichen höchstrichterlichen Rechtsprechung ist seit langem anerkannt, dass sich der Eigentümer eine Haftung als Zustandsstörer gemäß § 1004 BGB nicht durch Verzicht auf sein Eigentum entziehen kann […] (vgl. dazu ausführlich BGH, Urt. v. 30.3.2007 – V ZR 179/06, NJW 2007, 2182 = juris Rn. 10; Urt. v. 4.2.2005 – V ZR 142/04, NJW 2005, 1366 = juris Rn. 6.)“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 23). Ferner hätten die Antragsteller selbst ohne die Vorschrift des § 56 Satz 4 NBauO nicht darauf vertrauen können, als ehemalige Eigentümer und Grundstücksverantwortliche behördlich vollkommen unbehelligt zu bleiben. Die niedersächsische Polizei hätte im Zweifel auf Grundlage der §§ 7 Abs. 3, 11 NPolG zur Gefahrenabwehr einschreiten können.
Das OVG ergänzt hinsichtlich der Schutzwürdigkeit des Vertrauens der Antragsteller: „Eine Fortgeltung einer einmal begründeten gefahrenabwehrrechtlichen Verantwortlichkeit galt gemäß § 4 Abs. 3 Satz 4 BBodSchG darüber hinaus unabhängig von Landesrecht nach Bundesrecht. Zudem wäre ein dennoch entstandenes Vertrauen eines Eigentümers darauf, dass er sich durch Dereliktion seiner Verantwortlichkeit entziehen und gleichzeitig die in der Vergangenheit gezogenen Nutzungen behalten könnte, angesichts des Art. 14 Abs. 2 GG, wonach Eigentum verpflichtet und sein Gebrauch zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen soll, nicht schutzwürdig […] (vgl. dazu ausfürhlich BVerwG, Beschl. v. 14.11.1996 – 4 B 205/96, NVwZ 1997, 577 = juris Rn. 3)“ (NdsOVG, a.a.O., Rn. 23).
Kurzum stellt die Entscheidung hervorragend heraus, dass „Eigentum“ als auf Langfristigkeit ausgelegtes und normgeprägtes Grundrecht zwar zweifellos ein Vertrauen in die Rechtsposition als Eigentümer und alle damit verbundenen Rechte begründet. Jedoch strahlen diese starke Rechtsposition des Eigentümers und alle damit verbundenen Pflichten (wenigstens für eine gewisse Dauer) gleichsam nach, sodass im Gegenzug kein allzu starkes oder gar schutzwürdiges Vertrauen durch eine Eigentumsaufgabe pro forma begründet wird. Selbst wenn man formell also alle Schritte unternimmt, um sich von seinem Eigentum und den einhergehenden Pflichten zu lösen, kann ehemaliges Eigentum durchaus ebenso verpflichten.
Dogmatische Vertiefung
JurCase informiert:
Du interessierst dich für eine gelungene Examensvorbereitung auch für die dogmatische Vertiefung zu dieser Entscheidung?
Kein Problem! Die komplette Besprechung des Falls nebst dogmatischer Vertiefung gibt es hier für dich zum kostenlosen Download:
HIER DOWNLOADENAssessor Juris jetzt kostenlos downloaden!
In unserem E-Book Assessor Juris findest du jedoch nicht nur die Kategorie #Examensrelevant mit examensrelevanten Fällen, sondern es bietet darüber hinaus noch so viel mehr:
- Erhalte in unserer Rubrik #Referendariat wertvolle Einblicke rund um den juristischen Vorbereitungsdienst, in dieser Ausgabe sind das erneut besondere Einblicke in die jeweiligen Stationen.
- In der Rubrik #Gewusst erhältst du indes nützliche Insights u.a. zur aktuellen Rechtsprechung aus dem Zivil-, dem Straf- und dem Öffentlichen Recht.
- Mit dem Erwerb des Titels „Assessor Juris“ und dem damit zusammenhängenden Abschluss der juristischen Ausbildung geht es in den #Karrierestart. In dieser Rubrik findest du deshalb hilfreiche Tipps und Tricks von Praktiker:innen zum Karriereeinstieg.
Wer sind HLB Schumacher Hallermann?
HLB Schumacher Hallermann ist eine mittelständische Rechtsanwaltskanzlei, die von der steuerzentrierten Rechtsberatung kommt und sich nunmehr intensiv auch auf klassische Rechtsgebiete ausrichtet hat. Besonderes Merkmal: Konsequente Entwicklung spezieller und innovativer Beratungsfelder (Glücksspielbesteuerung, Glücksspielregulierung, eSport). Aus dem Herzen von Münster heraus beraten wir Mandanten persönlich und lösungsorientiert. Dabei ist uns eine offene und ehrliche Kommunikation gegenüber dem Mandanten wichtig.
Erfahre hier mehr:
Oder bewirb dich direkt hier:

