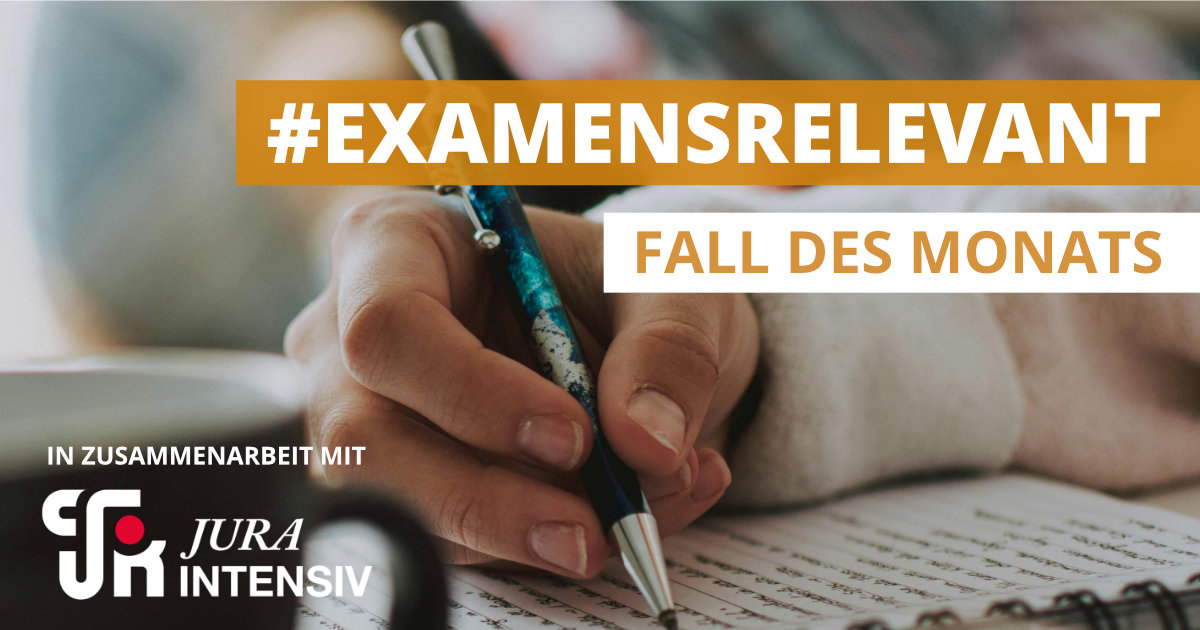
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 09.12.2024, Az.: 14 W 87/24 (Wx)
Problem: Wechselbezüglichkeit gem. § 2270 BGB
Einordnung: Erbrecht
In Kooperation mit Jura Intensiv präsentieren wir dir den #examensrelevanten Fall des Monats. Dieser bietet einen Sachverhalt mit Fragestellung, sodass der Fall eigenständig gelöst werden kann. Die hier präsentierten Lösungen enthalten in aller Regel auch weiterführende Hinweise für eine optimale Examensvorbereitung.
Einleitung
Ehegatten haben das Privileg, ein gemeinschaftliches Testament zu errichten. Dies bietet ihnen die Möglichkeit, gem. § 2270 BGB so genannte wechselbezügliche Verfügungen zu treffen, welche nach dem Tod des Erstversterbenden den Überlebenden gem. § 2271 BGB binden, wenn dieser nicht das Erbe ausschlägt. Von nicht wechselbezüglichen Verfügungen kann sich der Überlebende hingegen lösen, indem er z.B. ein neues Testament errichtet.
Sachverhalt
B 1 ist die zweite Ehefrau des Erblassers (E), der 2021 verstorben ist. Die Eheschließung fand 1983 statt. B 2 ist ein Sohn des E aus erster Ehe. Die erste Ehefrau des E ist 1981 vorverstorben. Ein weiterer gemeinsamer Sohn des E und seiner ersten Ehefrau ist am 1998 vorverstorben. E war an der Errichtung der folgenden letztwilligen Verfügungen beteiligt:
Zunächst errichtete er am 14.06.1980 formgemäß ein gemeinschaftliches Testament mit seiner ersten Ehefrau mit folgendem Inhalt:
„Testament:
I. Wir setzen uns gegenseitig zu befreiten Vorerben ein.
II. Nacherben auf das Erbe des Letztverstorbenen sollen unsere Söhne A. und M. zu je ½ sein.
III. Die Nacherbfolge soll eintreten beim Tode des Letztversterbenden.“
Dann errichtete er am 21.06.2007 formgemäß ein gemeinschaftliches Testament mit der B 1 mit folgendem Inhalt:
„Testament
Wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein. Nach dem Ableben des Letztverbleibenden ist die Tochter B Alleinerbin.“
Schließlich errichtete E mit der B1 am 28.05.2019 formgemäß ein gemeinschaftliches Testament mit folgendem Inhalt:
„Testament
Wir … setzen uns hiermit gegenseitig zu Alleinerben ein.
Für den Fall, dass der Letztlebende von uns keine anderweitige Bestimmung trifft, wird Erbe des Letztlebenden von uns bei dessen Tod A.“
B1 ist der Ansicht, Alleinerbin nach dem Tod des E zu sein. Sie meint, dass ihrer Erbeinsetzung im gemeinschaftlichen Testament vom 28.05.2019 keine Bindungswirkung aus dem gemeinschaftlichen Testament vom 14.06.1980 entgegenstehe. Bei lebensnaher Auslegung enthalte das gemeinschaftliche Testament vom 14.06.1980 nämlich keine Bestimmungen hinsichtlich des Nachlasses des Letztversterbenden. B2 widerspricht.
Zu Recht?
Leitsatz
- Die in einem gemeinschaftlichen Testament enthaltenen Formulierungen „Wir setzen uns gegenseitig zu befreiten Vorerben ein.“ und „Nacherben auf das Erbe des Letztverstorbenen sollen unsere Söhne … zu je ½ sein.“ legen eine Auslegung dahingehend nahe, dass hierin die Anordnung einer Vor- und Nacherbschaft nach dem Erstversterbenden und zugleich die Einsetzung der gemeinsamen Kinder zu gleichberechtigten Vollerben nach dem Letztversterbenden zu sehen ist.
- Im Fall der gegenseitigen Einsetzung des längerlebenden Ehegatten als (gesamt-)befreiten Vorerben besteht ein Erfahrungssatz, dass ein Ehegatte den anderen nur deswegen als befreiten Vorerben eingesetzt hat, weil er darauf vertraut hat, dass das beim Tod des Überlebenden verbliebene gemeinsame Vermögen auf die gemeinsamen Kinder übergehen wird.
Lösung
A. Alleinerbenstellung der B1
B1 könnte durch gemeinschaftliches Testament vom 28.05.2019 und den Tod des E Alleinerbin geworden sein.
JuraIntensiv informiert:
Prüfungsschema
I. Testierwille
II. Wirksamkeit
• Voraussetzungen d. § 2265 BGB
• Testierfähigkeit gem. § 2229 BGB
• Höchstpersönliche Errichtung gem. §§ 2064, 2065 BGB
• Einhaltung der Form
• Keine Nichtigkeit gem. §§ 134, 138 BGB
• Keine Anfechtung analog § 2281
• BGB i.V.m. §§ 2078 ff. BGB
• Kein Widerruf gem. §§ 2253 ff. i.V.m. §§ 2271 BGB
III. Keine Ausschlagung des Erbes
IV. Keine entgegenstehende Bindungswirkung gem. § 2271 II 1, 2270 BGB
I. Auslegung des Testierwillens
Das Testament vom 28.05.2019 enthält im ersten Satz die letztwillige Anordnung von Todes wegen, nach der der überlebende Ehegatte zunächst Alleinerbe sein soll. Indem B1 den Ehegatten, den E, überlebt hat, wäre sie nach dem Testierwillen des Erblassers in diesem Testament die Alleinerbin.
II. Wirksamkeit des Testaments
Das Testament vom 28.05.2019 müsste wirksam sein. Das Recht, ein gemeinschaftliches Testament zu errichten, steht gem. § 2265 BGB Eheleuten zu. B1 und E waren verheiratet, weshalb die Voraussetzungen des § 2265 BGB erfüllt sind. An ihrer Testierfähigkeit gem. § 2229 BGB bestehen keine Zweifel. Das Testament wurde höchstpersönlich in der zulässigen Form gem. §§ 2267, 2247 BGB errichtet. Es ist weder eine Anfechtung noch ein Widerruf erfolgt, ferner hat B1 das Erbe nicht ausgeschlagen.
III. Keine entgegenstehende Bindungswirkung gem. §§ 2271 II 1, 2270 BGB
Der Alleinerbenstellung könnte die Bindungswirkung des Testaments vom 14.06.1980 entgegenstehen. Dies wäre der Fall, wenn eine wechselbezügliche Verfügung gem. § 2270 BGB vorläge, nach der nach dem Tod des E einer seiner Abkömmlinge aus erster Ehe zum Erben eingesetzt wäre. In diesem Fall wäre E im Jahr 2019 nicht mehr in der Verfügung frei gewesen, B1 zur Alleinerbin nach seinem Tod einzusetzen.
[32] Wechselbezüglich sind nach § 2270 Abs. 1 BGB diejenigen in einem gemeinschaftlichen Ehegattentestament getroffenen Verfügungen, von denen anzunehmen ist, dass die Verfügung des einen nicht ohne die Verfügung des anderen getroffen sein würde. (…). Die Wechselbezüglichkeit von Verfügungen in einem gemeinschaftlichen Ehegattentestament ist vorrangig durch individuelle Auslegung zu ermitteln. Lediglich wenn diese zu keinem zweifelsfreien Ergebnis führt, kommt die Anwendung der Auslegungsregel des § 2270 Abs. 2 BGB in Betracht. (…). [= Verhältnis von § 2270 I BGB zu § 2270 II BGB]
Zu prüfen ist, welche Bedeutung die Bestimmungen unter II. und III. im Testament vom 14.06.1980 haben, in denen M und A als Nacherben nach dem Tod des Letztversterbenden eingesetzt wurden, während sich das Ehepaar zugleich als befreite Vorerben eingesetzt hat. Bei einem Berliner Testament i.S.d. § 2269 BGB wären die Begriffe „Vollerben“ sowie „Schlusserben“ üblich. Ein Nacherbe ist Erbe, erbt allerdings nach dem Vorerben. Ein Schlusserbe ist beim Tod des erstversterbenden Ehegatten zunächst enterbt, erbt schließlich nach dem Tod des Letztversterbenden. Die hier gewählte Mischform bedarf der Auslegung.
[33] Für die vor Anwendung der Auslegungsregel des § 2270 Abs. 2 BGB erforderliche Auslegung nach dem tatsächlichen Willen der Erblasser besteht nach zutreffender Meinung ein Erfahrungssatz, dass ein Ehegatte bei der gegenseitigen Erbeinsetzung seine Kinder beim Tod als Erstversterbender nur enterbt, weil er darauf vertraut, dass das gemeinsame Vermögen beim Tod des Überlebenden auf die gemeinsamen Kinder übergehen wird. (…). Für den – vorliegend relevanten – Fall der Einsetzung des längerlebenden Ehegatten als befreiten Vorerben, der jedenfalls bei einer Gesamtbefreiung. (…) eine mit einem Vollerben in vielerlei Hinsicht vergleichbare Rechtsstellung innehat, gilt nach Auffassung des Senats Gleiches. Wenn sich Ehegatten wechselseitig zu befreiten Vorerben einsetzen, enterben sie ihre als Nacherben vorgesehenen eigenen Kinder – anders als bei einem „klassischen“ Berliner Testament – zwar nicht; in Hinblick auf die Befreiung von den Beschränkungen
eines Vorerben hängt es gleichwohl maßgeblich vom Verhalten des überlebenden Ehegatten ab, ob und inwieweit die Nacherben vom Vermögen des Erstversterbenden noch profitieren werden. Wer die eigenen Kinder vermögensrechtlich absichern will, für den ersten eigenen Todesfall aber gleichwohl einen umfänglich befreiten Vorerben einsetzt, tut dies – insoweit nicht anders als bei einem klassischen Berliner Testament – im Bewusstsein und Vertrauen darauf, dass wegen der Erbeinsetzung des anderen Ehegatten jedenfalls das zum Zeitpunkt des Ablebens des Letztversterbenden verbliebene gemeinsame Vermögen eines Tages auf die Kinder übergehen wird. Das Gesetz schützt dieses Vertrauen der Eheleute in den Bestand einer solchen Regelung, (…) indem es nach dem Tod des Erstversterbenden den Widerruf grundsätzlich ausschließt (§ 2271 Abs. 2 Satz 1 BGB).[35] Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist davon auszugehen, dass der Erblasser und dessen vorverstorbene erste Ehefrau M. in dem gemeinschaftlichen Testament vom 14.06.1980 hinsichtlich des Vermögens des Erstversterbenden (befreite) Vor- und Nacherbschaft, hinsichtlich des Vermögens des Letztversterbenden die Einsetzung der gemeinsamen Kinder zu gleichberechtigten Vollerben angeordnet haben (…). Bei der Einsetzung der beiden Söhne als gleichberechtigte Erben nach dem Letztversterbenden handelt es sich um eine wechselbezügliche Verfügung im Sinne des § 2070 Abs. 1 BGB. (…).
[37] (…). Wenn es im Testament heißt, „Nacherben auf das Erbe des Letztverstorbenen sollen unsere Söhne A. und M. zu je ½ sein.“ und „Die Nacherbfolge soll eintreten, beim Tod des Letztversterbenden.“, lässt sich den Worten „auf das Erbe des Letztverstorbenen“ entnehmen, dass die Eheleute – was für ein gemeinschaftliches Testament zudem typisch ist – auch eine Regelung hinsichtlich der Erbfolge nach dem Letztverstorbenen treffen und sicherstellen wollten, dass die gemeinschaftlichen Kinder das gesamte verbleibende Vermögen beider Ehegatten erhalten. (…). Dass einerseits die Verwendung des Begriffes „Nacherben“ bei einer juristischen Betrachtung lediglich hinsichtlich des Vermögens des Erstverstorbenen zutreffend ist, andererseits das Vermögen des Erstverstorbenen nicht zum „Erbe des Letztversterbenden“ zählt, sondern aufgrund des ersten Erbfalls an die gemeinschaftlichen Söhne geht, steht der hier vorgenommenen Auslegung nicht entgegen, sondern belegt lediglich einen juristisch unsauberen Sprachgebrauch, der bei testierenden Laien nach den Erfahrungen des Senats nicht selten zu beobachten ist.
JuraIntensiv informiert:
Beim gemeinschaftlichen Testament können sich die Ehegatten zum einen für die Trennungslösung entscheiden. Dabei wird der überlebende Ehegatte Vorerbe mit den Rechtsfolgen der §§ 2110 ff. BGB und werden die Abkömmlinge Nacherben. Als Nacherben sind sie Erben nach dem Letztversterbenden, aber als Erben nicht enterbt.
Zum anderen können die Ehegatten sich für die Einheitslösung entscheiden. Dabei wird der überlebende Ehegatte Vollerbe und werden die Abkömmlinge Schlusserben. Das heißt, dass sie beim Tod des Erstversterbenden nicht erben, sondern warten müssen, bis der überlebende Ehegatte verstirbt, in der Hoffnung, dass dann noch etwas übrig ist.
Indem sich die Ehegatten als „befreite Vorerben“ bezeichneten, wählten sie eine Mischform, die auslegungsbedürftig ist.
Den Ehegatten ging es um zwei Punkte: Der überlebende Ehegatte sollte über das Vermögen des Erstversterbenden frei verfügen dürfen, das Vermögen des Letztversterbenden sollte an die beiden Söhne als Vollerben fallen.
Ergebnis der Auslegung: Die Einsetzung der Söhne war wechselbezüglich i. S. d. § 2270 I BGB.
Die Mischform entstand durch den unsauberen Sprachgebrauch juristischer Laien.
Damit ist die Einsetzung der B1 als Alleinerbin in den gemeinschaftlichen Testamenten vom 21.06.2007 und vom 28.05.2019 unwirksam. Mit dem Tode der ersten Ehefrau des E trat die in § 2271 Abs. 2 Satz 1 BGB angeordnete erbrechtliche Bindung des überlebenden Erblassers an die wechselbezügliche letztwillige Verfügung zugunsten der gemeinsamen Söhne ein, die ihn hinderte, diese noch wirksam zu widerrufen oder abweichend von ihr letztwillig zu verfügen.
B. Ergebnis
B1 ist nicht Alleinerbin nach dem Erblasser E.
RA – Rechtsprechungs-Auswertung
für Studierende und Referendare
In der monatlich erscheinenden Ausbildungszeitschrift „RA“ von Jura Intensiv werden examensrelevante Urteile prüfungsorientiert aufbereitet.
Ob im Abo, als Print- oder Digitalversion – mit der RA bist Du immer über die aktuellsten Entscheidungen informiert.
JurCase Mietangebot für dein
Zweites Staatsexamen
Für alle Bundesländer bietet JurCase die zugelassenen Hilfsmittel auf Basis der Prüfungsordnung der jeweiligen Bundesländer zur Miete an.
Du kannst je nach Bedarf nur die Examenskommentare, nur die Gesetzestexte oder das Kombi-Paket mit allen Kommentaren und Gesetzestexten bei JurCase mieten.



