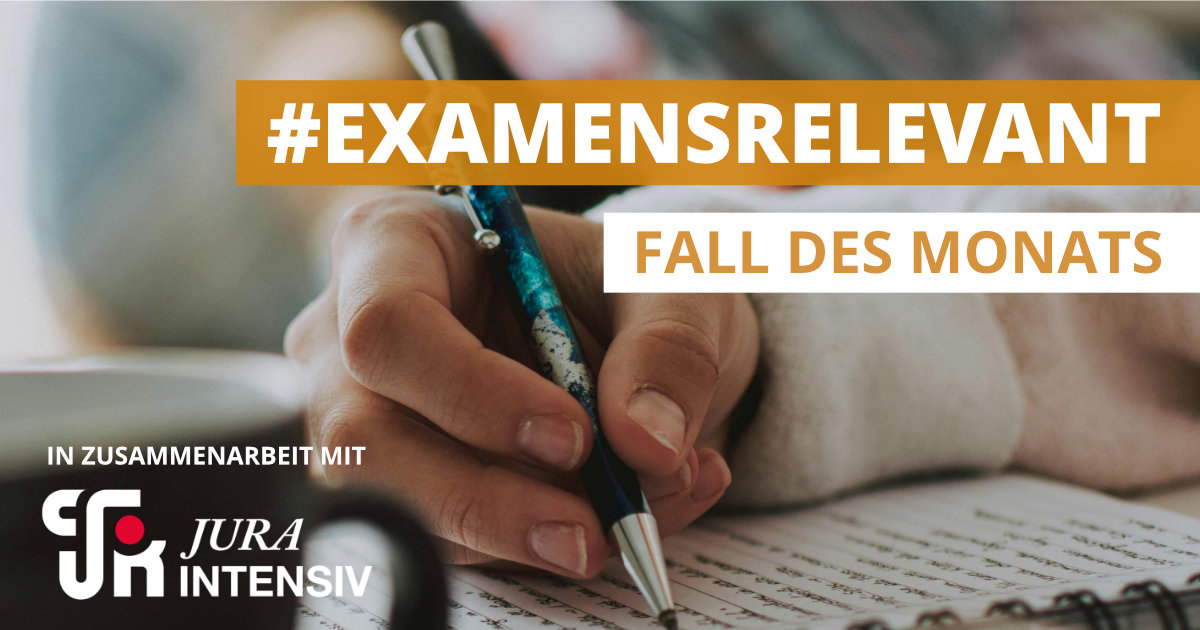
BGH, Beschluss vom 14.01.2025, Az.: 4 StR 444/24
Problem: § 255 StGB durch Lösegeldforderung für Handy
Einordnung: Strafrecht BT II / Raub und räuberische Erpressung
In Kooperation mit Jura Intensiv präsentieren wir dir den #examensrelevanten Fall des Monats. Dieser bietet einen Sachverhalt mit Fragestellung, sodass der Fall eigenständig gelöst werden kann. Die hier präsentierten Lösungen enthalten in aller Regel auch weiterführende Hinweise für eine optimale Examensvorbereitung.
Einleitung
Der BGH befasst sich im vorliegenden Beschluss insbesondere mit den Voraussetzungen der räuberischen Erpressung gem. §§ 253 I, 255 StGB.
Sachverhalt
Der Angeklagte A ließ sich von dem Geschädigten G dessen Smartphone zur Benutzung als Taschenlampe geben. Kurze Zeit später steckte er das Smartphone in seine Jacke und forderte für dessen Rückgabe unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Als G angab, kein Geld zu haben, erkannte A, dass von G kein Bargeld zu erlangen sein werde. Er forderte deshalb G dazu auf, ihm die PIN für das Smartphone zu geben, um dieses nach Freischaltung verkaufen zu können. Nachdem G die PIN mitgeteilt hatte, ließ ihn A los.
Strafbarkeit des A?
Leitsatz der Redaktion
Die Abforderung einer PIN zur Ermöglichung des Verkaufs eines im Besitz des Täters befindlichen fremden Smartphones stellt eine Manifestation seiner Zueignungsabsicht dar.
PRÜFUNGSSCHEMA: RÄUBERISCHE ERPRESSUNG, §§ 253 I, 255 StGB
A. Tatbestand
I. Qualifiziertes Nötigungsmittel
II. Opferreaktion
III. Vermögensnachteil
IV. Kausalität I. – II. und II. – III.
V. Vorsatz bzgl. I. bis IV. (und Finalität)
VI. Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung
B. Rechtswidrigkeit und Schuld
Lösung
A. Strafbarkeit gem. §§ 253 I, 255, 22, 23 I StGB durch die Bargeldforderung
Dadurch, dass A dem G ein Messer vorhielt und Bargeld im Gegenzug für die Rückgabe des Smartphones forderte, könnte A sich wegen versuchter räuberischer Erpressung gem. §§ 253 I, 255, 22, 23 I StGB strafbar gemacht haben.
I. Vorprüfung
Da A von G kein Geld erlangt hat, ist keine Strafbarkeit wegen vollendeter Tat gegeben. Die Strafbarkeit des Versuchs der räuberischen Erpressung ergibt sich aus §§ 255, 249 I, 12 I StGB i.V.m. § 23 I StGB.
II. Tatentschluss
1. Bzgl. qualifizierten Nötigungsmittels
Durch das Vorhalten des Messers wollte A mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben des G drohen, hatte somit Tatentschluss bzgl. der Anwendung eines qualifizierten Nötigungsmittels.
2. Bzgl. Opferreaktion
A müsste sich eine tatbestandsmäßige Opferreaktion des G vorgestellt haben. Zwar ist im Rahmen der Erpressungsdelikte streitig, ob jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen als Opferreaktion genügt (so die sog. Spezialitätstheorie, BGH, Beschluss vom 24.04.2018, 5 StR 606/17, RA 2018, 557) oder ob insofern – wie bei § 263 I StGB – eine Vermögensverfügung erforderlich ist (so die sog. Verfügungs- oder Exklusivitätstheorie, vgl. Schönke/Schröder, StGB, § 253 Rn 3, 8). A hatte sich vorgestellt, dass G ihm Geld geben würde, was nicht nur eine Handlung wäre, sondern auch das Vermögen des G unmittelbar mindern und somit eine Vermögensverfügung darstellen würde. Somit hatte A nach beiden Meinungen Tatentschluss bzgl. einer tatbestandsmäßigen Opferreaktion.
3. Bzgl. Vermögensnachteil
A müsste auch Tatentschluss bzgl. eines Vermögensnachteils bei G gehabt haben.
Selbst wenn A vorgehabt hätte, G gegen Zahlung von Bargeld das Smartphone zurückzugeben, wäre dies kein Äquivalent gewesen, da G (aus § 985 BGB) einen Anspruch gegen A auf unentgeltliche Rückgabe des Smartphones hatte. Dessen war sich A auch bewusst, sodass er Tatentschluss bzgl. eines Vermögensnachteils hatte.
4. Bzgl. Kausalität 1. – 2. und 2. – 3.
A hatte auch Tatentschluss bzgl. einer durchgehenden Kausalität.
5. Finalität
A hat gedroht, um G zur Herausgabe des Geldes zu bewegen, sodass der erforderliche Finalzusammenhang gegeben ist.
6. Bereicherungsabsicht
A hatte die Absicht, sich Bargeld von G zu verschaffen, handelte also mit Bereicherungsabsicht.
7. Bzgl. Rechtswidrigkeit und Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung
A wusste, dass er keinen Zahlungsanspruch gegen B hatte, hatte also Tatentschluss bzgl. der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung. Er wusste, dass die Bereicherung die Kehrseite des Vermögensnachteils bei G wäre, und hatte somit Tatentschluss bzgl. der Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung.
III. Unmittelbares Ansetzen, § 22 StGB
IV. Rechtswidrigkeit und Schuld
A handelte rechtswidrig und schuldhaft.
V. Kein Rücktritt gem. § 24 StGB
A hatte erkannt, dass G kein Geld bei sich führte, sodass er dachte, dass er die räuberische Erpressung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht mehr vollenden könne. Aufgrund des Fehlschlags seines Erpressungsversuchs scheidet ein Rücktritt des A gem. § 24 StGB aus.
VI. Ergebnis
A ist strafbar gem. §§ 253 I, 255, 22, 23 I StGB.
B. Strafbarkeit gem. §§ 253 I, 255 StGB durch Abnötigen der PIN
Dadurch, dass A den G dazu zwang, ihm die PIN des Smartphones zu nennen, könnte A sich wegen räuberischer Erpressung gem. §§ 253 I, 255 StGB strafbar gemacht haben.
I. Tatbestand
1. Qualifiziertes Nötigungsmittel
A hat mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben gedroht und somit ein qualifiziertes Nötigungsmittel angewendet (s.o.).
2. Opferreaktion
Die Nennung der PIN müsste eine tatbestandsmäßige Opferreaktion des G darstellen.
Nach der Spezialitätstheorie kommt als Opferreaktion jedes Handeln, Dulden oder Unterlassen in Betracht (s.o.). Die Nennung der PIN ist eine Handlung und somit nach dieser Meinung eine tatbestandsmäßige Opferreaktion.
Die Verfügungs- oder Exklusivitätstheorie verlangt als Opferreaktion bei den Erpressungsdelikten eine Vermögensverfügung. Fraglich ist, ob die Preisgabe der PIN eine solche darstellt. Nach der engen Verfügungstheorie kann eine Vermögensverfügung bei den Erpressungsdelikten – ebenso wie beim Betrug – nur angenommen werden, wenn das Verhalten des Opfers sich unmittelbar vermögensmindernd auswirkt (vgl. Wessels/Hillenkamp/Schuhr, BT 2, Rn 755). Die bloße Preisgabe der PIN mindert das Vermögen des G nicht unmittelbar. Allerdings kann – wie auch bei § 263 I StGB – eine konkrete Gefährdung des Vermögens für eine unmittelbare Vermögensminderung ausreichen. Es ist allerdings nicht ersichtlich, dass die Preisgabe der PIN das Vermögen des G konkret gefährdet. Dadurch erhält A zwar die Möglichkeit, das Smartphone zu nutzen, dies würde das Vermögen des G jedoch nur dann gefährden, wenn jedes von A geführte Telefongespräch dem G unmittelbar in Rechnung gestellt würde, wovon nicht auszugehen ist. Die Möglichkeit des A, das Smartphone zu verkaufen, hätte auch ohne die Preisgabe der PIN bestanden. Nach der engen Verfügungstheorie liegt somit keine tatbestandsmäßige Opferreaktion des G vor. Nach der weiten Verfügungstheorie genügt für eine Vermögensverfügung bei den Erpressungsdelikten – anders als beim Betrug – zwar auch eine nur mittelbare Vermögensminderung (vgl. Lackner/Kühl/Heger, StGB, § 253 Rn 3). Auch eine solche ist allerdings aus den genannten Gründen nicht gegeben.
Zwar ist der Verfügungstheorie zuzugestehen, dass zwischen den Erpressungsdelikten und dem Betrug eine strukturelle Verwandtschaft besteht, die es nahe legt, in §§ 253 I; 255 StGB – ebenso wie in § 263 I StGB – das Erfordernis einer Vermögensverfügung hineinzulesen. Allerdings setzt eine Verfügung immer eine gewisse Freiwilligkeit voraus, die bei den Erpressungsdelikten als bewusste Selbstschädigungsdelikte – anders als beim Betrug, der ein unbewusstes Selbstschädigungsdelikt darstellt – nicht gegeben sein kann. Da die Exklusivitätstheorie auch bei vis absoluta als Tatmittel zu Strafbarkeitslücken führen kann, wenn § 249 I StGB (z.B. wegen fehlender Zueignungsabsicht) nicht greift, ist der Spezialitätstheorie zu folgen. Eine tatbestandliche Opferreaktion liegt somit vor.
3. Vermögensnachteil
Da die Preisgabe der PIN allerdings nicht einmal mittelbar (s.o.) zu einer Vermögensminderung bei G geführt hat, ist ein Vermögensnachteil nicht gegeben.
II. Ergebnis
A ist nicht strafbar gem. §§ 253 I, 255 StGB.
C. Strafbarkeit gem. § 246 I StGB
Durch das Erzwingen der Preisgabe der PIN könnte A sich aber wegen Unterschlagung gem. § 246 I StGB strafbar gemacht haben.
I. Tatbestand
1. Fremde bewegliche Sache
Das im Eigentum des G stehende Smartphone ist für A eine fremde bewegliche Sache.
2. Zueignung
A wollte das Smartphone verkaufen, also seinem Vermögen einverleiben und hatte deshalb Aneignungswillen. Auch wollte er den Berechtigten G dauerhaft aus der Eigentümerposition verdrängen, hatte also auch Enteignungswillen und somit Zueignungswillen.
„[4] […] ist die Strafkammer zutreffend davon ausgegangen, dass in der Abforderung der PIN zur Ermöglichung des Verkaufs des Smartphones eine Manifestation einer Zueignungsabsicht zu sehen sei.“
Eine Manifestationshandlung ist somit auch gegeben, sodass eine Zueignung vorliegt.
3. Rechtswidrigkeit der Zueignung
A hatte keinen Anspruch auf die Zueignung, sodass diese rechtswidrig war.
4. Vorsatz
A handelte mit Vorsatz bzgl. der objektiven Tatumstände.
II. Rechtswidrigkeit und Schuld
A handelte rechtswidrig und schuldhaft.
III. Ergebnis
A ist strafbar gem. § 246 I StGB.
D. Konkurrenzen und Gesamtergebnis
„[5] § 246 Abs. 1 StGB sieht vor, dass eine Verurteilung wegen Unterschlagung zu entfallen hat, wenn die Tat in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist. Dies ist hier in Bezug auf die […] versuchte […] räuberische Erpressung der Fall.“
Im Ergebnis ist A also strafbar gem. §§ 253 I, 255, 22, 23 I StGB.
RA – Rechtsprechungs-Auswertung
für Studierende und Referendare
In der monatlich erscheinenden Ausbildungszeitschrift „RA“ von Jura Intensiv werden examensrelevante Urteile prüfungsorientiert aufbereitet.
Ob im Abo, als Print- oder Digitalversion – mit der RA bist Du immer über die aktuellsten Entscheidungen informiert.
JurCase Mietangebot für dein
Zweites Staatsexamen
Für alle Bundesländer bietet JurCase die zugelassenen Hilfsmittel auf Basis der Prüfungsordnung der jeweiligen Bundesländer zur Miete an.
Du kannst je nach Bedarf nur die Examenskommentare, nur die Gesetzestexte oder das Kombi-Paket mit allen Kommentaren und Gesetzestexten bei JurCase mieten.



